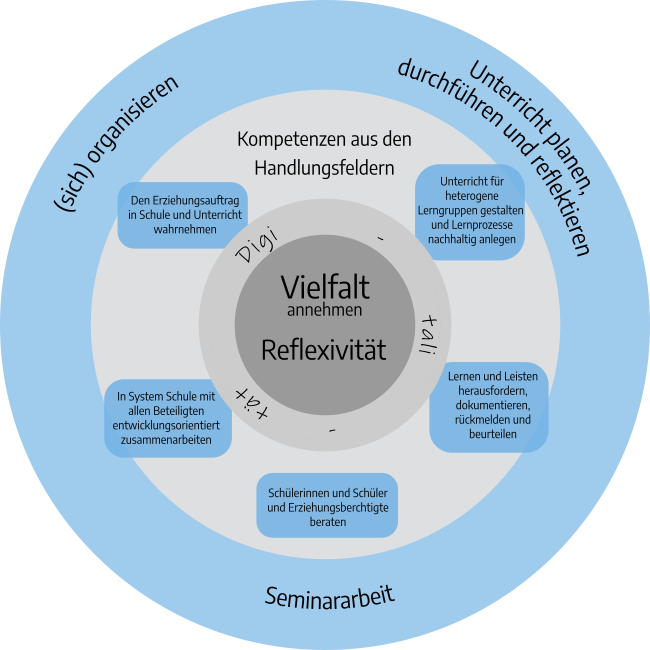Jede
Lehramtsanwärterin und jeder Lehramtsanwärter (LAA) gehört zwei Fachseminaren
und einem Kernseminar an. Die Kern- und Fachseminare finden jeweils am
Seminartag - derzeit: Donnerstag – in der Regel im ZfsL Münster statt. Für
die Ausbildung am ZfsL stehen durchschnittlich 7 Wochenstunden zur
Verfügung.
In
den jeweiligen Ausbildungsplänen der Fach- und Kernseminare, die fortlaufend
aufeinander abgestimmt werden, bilden die sogenannten Konkretionen den
Ausgangspunkt der seminardidaktischen Umsetzung der Ausbildungsveranstaltungen.
Durch die von den LAA zu generierenden Erschließungsfragen werden
Schwerpunktesetzungen und Priorisierungen im Sinne eines selbstverantworteten
Kompetenzerwerbsprozesses unter Anleitung, Beratung und Unterstützung vorgenommen. Diese aufeinander
abgestimmten Ausbildungspläne decken insgesamt alle Handlungsfelder ab.
Zu Anfang
der Ausbildung im Seminar findet zunächst eine Kompaktveranstaltung der
Kernseminare statt.
Vom 2.
bis zum 5. Ausbildungsquartal nehmen die Lehramtsanwärterinnen und Lehranwärter
pro Fachseminar an zwei Fachintensivtagen teil. Die Fachintensivtage
bieten vielfältige Möglichkeiten einer thematischen und inhaltlichen Vertiefung
von fachspezifischen Handlungssituationen, z.T. in Kooperation mit externen
Bildungseinrichtungen und Fachexpertinnen und -experten.
Vor
dem Hintergrund einer zukunftsgerichteten und in der Gemeinschaft gestalteten
Lernkultur findet im 2. und im 4. Quartal der Ausbildung jeweils ein Barcamp
statt. Das Barcamp ist eine offene Methode mit
offenen Workshops, deren
Inhalte und Ablauf von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Beginn des
Barcamps selbst entwickelt und im weiteren Verlauf gestaltet werden. Grundlage
für die Gestaltung der sogenannten „Barcamp-Sessions“ bildet die Arbeit in den
Lerngemeinschaften (siehe Punkt 7: Arbeit in Lerngemeinschaften).
Im 6.
Ausbildungsquartal finden die Fach- und Kernseminare in Form einer langfristig angelegten
Projektphase „Herausforderung“ statt. Eine „Herausforderung“ soll eine Selbsterprobung in einem der
beruflichen Handlungsfelder sein. Sie wird in 4 Projektetappen vollzogen:
Herausforderung finden, Bewährung gestalten, Erprobung erleben und Erfahrungen
reflektieren.